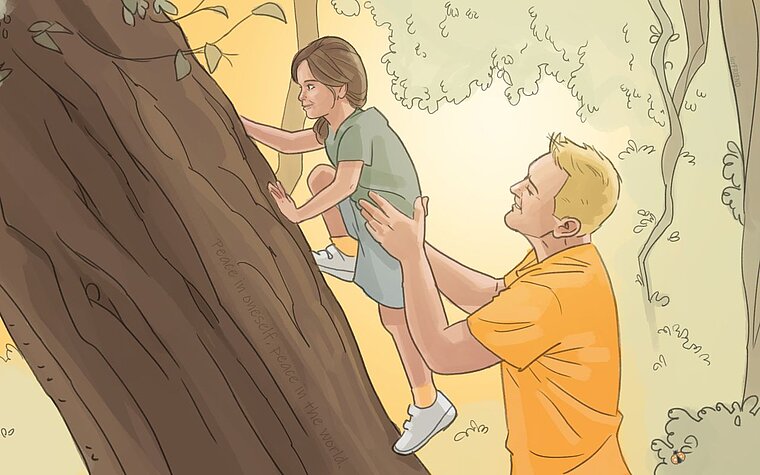Wechselmodell vs. Residenzmodell
Das Residenzmodell bezeichnet die herkömmliche Situation, bei der ein Elternteil das Kind in seinem Haushalt betreut, bei dem es wohnt und dauerhaft „residiert“. Der andere Elternteil beschränkt sich darauf, Barunterhalt zu leisten und das Kind im Rahmen seines Umgangsrechts regelmäßig zu sehen.
Konnten Sie sich mit Ihrem Ex-Ehepartner auf ein Wechselmodell einigen und betreuen Ihr Kind gleichermaßen, sollte es Ihnen auch möglich sein, den Unterhalt zu regeln. Der Unterhalt beim Wechselmodell erweist sich in der Praxis oft als echte Hürde. Schließlich geht es ums liebe Geld. Um herauszufinden, wer welchen Unterhalt leisten muss, sollten Sie wissen, worauf es dabei ankommt. Einfach zu sagen, "Ich betreue das Kind, also kürze ich den Unterhalt!", genügt jedenfalls nicht.
Video
Betreuung im Verhältnis von 50 : 50
Welche zeitlichen Vorgaben setzt das Wechselmodell voraus?
Nicht jeder Wechsel in der Betreuung erfüllt die Vorgaben des Wechselmodells. Möchten Sie infolge der regelmäßig wechselnden Betreuung Ihres gemeinsamen Kindes auch Ihre Unterhaltsleistungen reduzieren, müssen Sie darlegen und vortragen, in welchem zeitlichen Rhythmus und in welcher Intensität Sie Ihr Kind betreuen. Es kommt darauf an, dass Sie Ihr Kind in gleichem Maße betreuen wie Ihr Ex-Partner.
Möchten Sie sich umgekehrt darauf berufen, dass kein Wechselmodell vorliegt, müssen Sie darlegen und beweisen, dass der Schwerpunkt der Pflege und Erziehung des Kindes bei Ihnen und in Ihrem Haushalt liegt. Nur dann können Sie darauf bestehen, dass der andere Elternteil den vollen Kindesunterhalt zahlt.
Wann wird ein Wechselmodell nicht anerkannt?
Die Rechtsprechung musste sich bereits mit der zeitlichen Thematik beschäftigen. Leisten Sie selbst Barunterhalt, wird ein Wechselmodell nicht anerkannt, wenn Sie das Kind etwa nur zu einem Drittel betreuen (BGH FamRZ 2006, 1015). Es reicht auch nicht, wenn Sie das Kind an fünf von 14 Tagen oder in der Hälfte der Schulferien in Ihrem Haushalt betreuen (BGH FamRZ 2007, 707). Alle diese Modelle werden als unechte Wechselmodelle bezeichnet. Sie ändern nichts an Ihrer unbeschränkten Unterhaltspflicht für den Kindesunterhalt.
Allein dadurch, dass Sie über das bloße Umgangsrecht hinaus Betreuungsleistungen für das Kind erbringen, lässt sich kein Wechselmodell rechtfertigen. Auch wenn der andere Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut, durch den erweiterten Umgang entlastet wird, bleibt er in der Hauptverantwortung für das Kind. Schließlich muss er/sie sich dauerhaft darauf einrichten, dass er wegen der Betreuung des Kindes selbst nicht oder nur eingeschränkt arbeiten kann.
Wann wird ein echtes Wechselmodell anerkannt?
Ein sogenanntes „echtes“ Wechselmodell ist nur begründet, wenn beide Elternteile gleichermaßen Betreuungsleistungen erbringen oder umgekehrt, wenn kein Elternteil wesentlich mehr Betreuungsleistungen erbringt als der andere Teil. Nur dann erkennt die Rechtsprechung ein echtes Wechselmodell an. Ist dies nicht der Fall, liegt ein unechtes Wechselmodell vor. Die Unterscheidung ist wichtig, weil sich danach die Höhe der Unterhaltszahlungen richtet. Die Grenze zum unechten Wechselmodell überschreiten Sie ungefähr dann, wenn Ihre Betreuungsleistungen mehr als 10 % vom rechnerischen Mittel abweichen und Sie das Kind im Verhältnis von 40 zu 60 betreuen. Der Bundesgerichtshof hat dies ausdrücklich so klargestellt (BGH Urteil vom 12.3.2014, Az. XII ZB 234/13).
Wichtig und kennzeichnend für ein Wechselmodell ist auch, dass Sie das Kind wirklich betreuen und sich um die Belange des Kindes kümmern. Es genügt nicht unbedingt, wenn das Kind einfach nur bei Ihnen wohnt. Vielmehr sollten Sie es auch als Ihre Aufgabe betrachten, sich um Schule, medizinische Betreuung und Freizeitgestaltung zu kümmern und als Ansprechpartner für das Kind und für Dritte (z.B. Lehrer) zur Verfügung zu stehen.
Intensive Betreuung rechtfertigt keine Unterhaltskürzung
Allein der Umstand, dass Sie Ihr Umgangsrecht verantwortungsvoll wahrnehmen und das Kind intensiver und umfangreicher betreuen, als es dem vereinbarten Umgangsrecht entspricht, rechtfertigt es nicht, dass Sie Ihre Unterhaltspflicht zumindest teilweise als erfüllt betrachten. Sie sollten eine intensive Betreuung nicht zum Anlass nehmen, sich mit Ihrem Ex-Partner wegen der Unterhaltsfragen zu streiten. Ein solcher Streit wäre nur aussichtsreich, wenn Sie damit ein Wechselmodell begründen wollten. Angesichts der hohen Anforderungen an ein solches Wechselmodell sollten Sie die Unterhaltsfrage eher nüchtern und sachlich betrachten.
Welche Konsequenzen hat ein echtes Wechselmodell auf die Unterhaltspflicht?
Betreuen Sie Ihr gemeinsames Kind zu gleichen Anteilen, führt Ihre Betreuung keineswegs dazu, dass Sie keinen Barunterhalt mehr zahlen müssten. Vielmehr ist es so, dass beide Elternteile in der Unterhaltspflicht für das Kind stehen. Die Frage, in welcher Höhe die Elternteile Unterhalt für das Kind leisten müssen, richtet sich nach Ihren Einkommensverhältnissen. Vor allem können Sie sich jetzt nicht darauf berufen, dass Sie infolge Ihrer Pflege- und Erziehungsleistung Ihre Unterhaltspflicht erfüllen. Zwar ist die Pflege und Erziehung des Kindes als Unterhaltsleistung anerkannt, aber nur insoweit, als ein Elternteil das Kind hauptsächlich betreut, während der andere Elternteil lediglich den Umgang mit dem Kind pflegt. Andernfalls wären beide Elternteile vom Barunterhalt befreit, obwohl das Kind an sich nur betreut werden würde.
Kann ich das Wechselmodell auch gegen den Willen meines Ex-Partners beantragen?
Es erscheint naheliegend, dass Sie Ihre Barunterhaltspflicht vielleicht dadurch vermindern wollen, dass Sie das Wechselmodell praktizieren. Ist der andere Elternteil aber nicht damit einverstanden, kommt es darauf an, ob Sie das Wechselmodell auch gegen den Willen Ihres Ex-Partners durchsetzen können. Dazu hat der Bundesgerichtshof (Beschluss vom 1.2.2017, Az. XII ZB 601/15) klargestellt, dass bei fortbestehender gemeinsamer elterlicher Sorge jeder Elternteil das gleiche Recht daran hat, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
Eine Einschränkung ergibt sich aber daraus, dass das Kindeswohl einem Wechselmodell nicht entgegensteht. Gibt es insoweit keine Bedenken, können Sie durchaus erreichen, dass das Familiengericht ein Wechselmodell zugesteht und Sie Ihr gemeinsames Kind im gleichen Rhythmus wie der andere Elternteil betreuen können. Soweit Sie das Familiengericht bemühen, wird das Gericht prüfen, ob und inwieweit es dem Kind zuzumuten ist, abwechselnd von beiden Elternteilen betreut werden. Dazu kommt es entscheidend darauf an, dass beide Elternteile angemessen miteinander kommunizieren und kooperieren können. Fehlt es allein schon an diesen Voraussetzungen und ist Ihr Verhältnis konfliktbelastet, dürfte es regelmäßig nicht im Interesse des Kindes liegen, im Wechselmodell betreut zu werden. Dazu wird das Gericht Ihr Kind auch regelmäßig persönlich anhören.
Das Gericht wird berücksichtigen, dass das Kind durch den ständigen Wechsel von einem Haushalt zum anderen Haushalt belastet wird, sozusagen ständig auf gepackten Koffern sitzt und sich weder in dem einen Haushalt noch in dem anderen Haushalt wirklich heimisch und geborgen fühlt.
Einfluss auf das Kind kann verschieden sein
Sie sollten berücksichtigen, dass ein Wechselmodell nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Wenn Sie Ihr Kind beispielsweise nur am Wochenende oder in den Ferien betreuen, könnte der Einfluss auf Ihr Kind größer sein, da das Kind den Besuch und den Umgang mit Ihrer Person als Highlight, als persönliche Auszeichnung oder als Genuss empfindet. Der andere Elternteil, dem die alltägliche Betreuung obliegt, sieht sich hingegen infolge des alltäglichen Umgangs einer eher gewohnheitsmäßigen Beziehung ausgesetzt.
Ist ein Wechselmodell zweckmäßig?
Wechselmodelle werden eher kritisch betrachtet. Sie funktionieren in der Lebenspraxis nur, wenn Sie sich mit Ihrem Ex-Partner wirklich sachlich verständigen können und das Kind nicht darunter leidet, dass es abwechselnd im Haushalt beider Elternteile betreut wird. Um dem Kindeswohl einigermaßen gerecht zu werden, kommt es auf eine funktionierende Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit beider Elternteile an. Es muss Ihnen klar sein, dass die wechselnde Betreuung höhere Anforderungen an beide Elternteile und auch an das Kind stellt und beide Elternteile die Art und Weise, wie der jeweils andere mit dem Kind umgeht, es erzieht und pflegt und anerkennt, nicht ständig irgendwie in Zweifel ziehen können.
Sie müssen anerkennen, dass auch der andere Elternteil das gemeinsame Sorgerecht ausübt und in alltäglichen Angelegenheiten das gleiche Recht hat, Entscheidungen für das Kind so treffen wie Sie selbst auch. Genauso muss es Ihnen auch klar sein, dass Sie in gewichtigen Angelegenheiten des Kindes den anderen Elternteil einbeziehen müssen und keine Alleinentscheidungen treffen dürfen. Nur wenn Sie sich beide an diese Spielregeln halten, wird ein Wechselmodell funktionieren. Aber auch dann kommt es immer noch darauf an, dass Sie sich wegen des Unterhalts verständigen und nicht versuchen, den anderen Elternteil über Gebühr finanziell in die Pflicht zu nehmen.
Wie berechnet sich der Kindesunterhalt beim echten Wechselmodell?
Betreuen beide Elternteile das Kind gleichermaßen, ist der Barunterhalt wie folgt zu berechnen:
- Berechnen Sie Ihre Gesamteinkünfte. Hierzu addieren sie die bereinigten Nettoeinkommen von Ihnen und Ihrem Partner. Das bereinigte Nettoeinkommen ergibt sich aus Ihren Bruttoeinkommen abzüglich Steuern, Sozialversicherungsabgaben und anderen Verbindlichkeiten. Hieraus ergibt sich dann anhand der Düsseldorfer Tabelle der Unterhaltsbedarf des Kindes.
Mark und Clara leben getrennt und betreuen ihren zehnjährigen Sohn gleichermaßen im Wechselmodell. Mark verdient netto 2.700 EUR, Clara verdient netto 1.300 EUR. Ihr Gesamteinkommen beträgt also 4.000 EUR. Daraus ergibt sich nach der Düsseldorfer Tabelle in der Altersstufe 6 - 11 Jahre ein Kindesunterhalt in Höhe von 754 EUR (Stand: 1. Januar 2025). Dieser Betrag ist der Regelbedarf Ihres Kindes. - Auf den ermittelten Unterhaltsbedarf wird anschließend noch ein sog. Mehrbedarf addiert, der für zusätzliche Kosten in Form von Fahrten oder Miete für eine größere Wohnung der Partner steht.
Lebt Mark in zum Beispiel in Hamburg und Clara in München und fährt Mark daher regelmäßig nach München um den Sohn abzuholen, entstehen Fahrtkosten von 200 EUR, diese sind auf den Unterhaltsbetrag anzurechnen. Es ergibt sich als insgesamt ein Unterhaltsbedarf von 754 EUR+200EUR Anschließend wird ermittelt, wie die fälligen Unterhaltskosten auf die beiden Elternpartner aufgeteilt werden. Dies geschieht nicht etwa hälftig, sondern im Verhältnis der beiden Einkommen. Hierzu wird zunächst das bereinigte Nettoeinkommen berechnet, von dem dann der Selbstbehalt abgezogen wird. Aus diesem Einsatzbetrag genannten Einkommen wird anschließend ermittelt, wie viel jeder Elternteil zahlen muss.
Aus Gründen der Einfachheit nehmen wir an, dass beide Elternteile berufstätig sind und keine weiteren Aufwände haben: Mark hat somit ein bereinigtes Nettoeinkommen von 2.565 EUR, während sich Claudias bereinigtes Nettoeinkommen auf 1.235 EUR beläuft. Anschließend wird hiervon der Selbstbehalt, der sich für erwerbstätige Personen auf 1.160 EUR beläuft, abgezogen. Es ergibt sich ein Einsatzbetrag von 1.405 EUR für Mark und 75 EUR für Claudia oder ein gemeinsamer Einsatzbetrag von 1.480 EUR.
Es ergibt sich also für Mark ein Anteil von 1.405/1.480*754 EUR+200 EUR und für Claudia ein Anteil von 75/1.480*754 EUR+200EUR.
Ermittlung des zu zahlenden Anteils (Mark)
| Einsatzbetrag Mark | | 1.405 EUR |
| Gemeinsamer Einsatzbetrag | : | 1.480 EUR |
| Unterhaltsanspruch des Kindes | x | 754 EUR+200 EUR |
| Marks Anteil | = | 1.405/1.480*754 EUR+200 EUR |
| Hälftiges Kindergeld | - | 250 EUR / 2 EUR |
| Zwischenergebnis | = | ###ERG### EUR |
Ermittlung des zu zahlenden Anteils (Claudia)
| Einsatzbetrag Claudia | | 75 EUR |
| Gemeinsamer Einsatzbetrag | : | 1.480 EUR |
| Unterhaltsanspruch des Kindes | x | 754 EUR+200 EUR |
| Claudias Anteil | = | 75/1.480*754 EUR+200 EUR |
Mark muss an Claudia folgenden Betrag zahlen:
| Zahlbetrag | | 1.405/1.480*754 EUR+200 EUR |
| Hälftiges Kindergeld | - | 250 EUR / 2 EUR |
| Hälfte des Gesamtbedarfs | - | 754 EUR + 200 / 2 EUR |
| Ergebnis | = | ###ERG2### EUR |
- Im nächsten Schritt wird das Kindergeld jeweils zur Hälfte angerechnet. Dieses beträgt beim ersten und zweiten Kind seit 1. Januar 2025 250 EUR. Die Hälfte des Betrages wird demjenigen Partner, dem das Kindergeld ausgezahlt wird, zum zu zahlenden Unterhaltsbetrag hinzugerechnet, während dem anderen Partner die Hälfte des Kindergeldes vom zu zahlenden Unterhaltsbetrag abgezogen wird.
- Im letzten Schritt wird berechnet, welcher Partner wem wie viel zahlen muss. Hierzu wird ermittelt, welcher der beiden Elternteile mehr als die Hälfte des Gesamtbedarfs zahlt. Die Differenz zwischen dem gezahlten Betrag und der Hälfte des Gesamtbedarfs wird an den anderen Elternteil gezahlt.
In unserem Beispiel ist der Gesamtbedarf von Marks und Claudias gemeinsamen Kind 754 EUR+200 EUR, die Hälfte davon wäre also 754 EUR+200/2 EUR.
Nehmen wir an, dass Claudia das Kindergeld gezahlt bekommt, da sie über das geringere Einkommen verfügt. Ihr zu zahlender Betrag erhöht sich also um die Hälfte des Kindergeldes, also um 250 EUR/2 EUR, während sich Marks Anteil um denselben Anteil verringert.
Voraussetzung für diese Anrechnung ist natürlich, dass beide Elternteile anteilig Kosten für Kleidung, Schulbedarf und ähnliches beisteuern und sie sich auch über die Bedürfnisse des Kindes einig sind, nur so kann das Wechselmodell auch funktionieren.