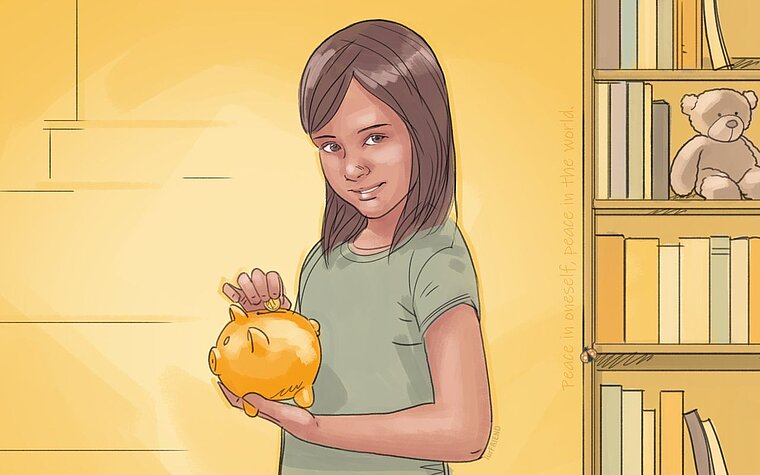Mindestkindesunterhalt: monatliche Beträge
Festgelegt wurden in der Mindestunterhaltsverordnung die folgenden monatlichen Beträge für den Mindestkindesunterhalt das Jahr 2025:
- Erste Altersstufe von 0 bis 5 Jahren: 482 EUR
- Zweite Altersstufe von 6 bis 11 Jahren: 554 EUR
- Dritte Altersstufe von 12 bis 17 Jahren: 649 EUR
Diese Beträge für den Mindestunterhalt für Kinder entsprechen der untersten Tabellengruppe der Düsseldorfer Tabelle, die zwar keine Gesetzeskraft hat, aber bundesweit für die Ermittlung des Kindesunterhalts verwendet wird. Diese Tabelle, die für zwei Unterhaltsberechtigte ausgelegt ist, enthält 15 Einkommensgruppen sowie 3 Altersgruppen für minderjährige Kinder und eine Altersgruppe für volljährige Kinder. Möchten Sie mit Hilfe der Düsseldorfer Tabelle den Kindesunterhalt ermitteln, brauchen Sie dazu lediglich den Unterhaltspflichtigen in seine Einkommensgruppe einzuordnen. Aus der Altersgruppe des Kindes können Sie dann ersehen, wie hoch sein monatlicher Unterhalt ist.
In der Düsseldorfer Tabelle ist das Kindergeld allerdings nicht berücksichtigt. Dieses wird in der Regel an denjenigen Elternteil gezahlt, bei dem das Kind lebt. Der barunterhaltspflichtige Elternteil hat aber Anspruch auf das hälftige Kindergeld, so dass er den monatlichen Mindestunterhalt für Kinder um das halbe Kindergeld kürzen darf, wenn der andere Elternteil das Kindergeld erhält. Das Kindergeld beläuft sich monatlich auf:
- 250 EUR für das erste und zweite Kind
- 250 EUR für das dritte Kind
- 250 EUR für das vierte und jedes weitere Kind
Das hat folgende monatliche Zahlbeträge des Barunterhaltspflichtigen für den Mindestkindesunterhalt 2025 zur Folge, wobei der Zahlbetrag das ist, was der Pflichtige tatsächlich zahlen muss:
- Erste Altersgruppe (0 bis 5 Jahre):
Für das erste und zweite Kind jeweils 482 EUR-250 EUR/2 EUR, für das dritte Kind 482 EUR-250 EUR/2 EUR sowie für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 482 EUR-250 EUR/2 EUR - Zweite Altersgruppe (6 bis 11 Jahre):
Für das erste und zweite Kind jeweils 554 EUR-250 EUR/2 EUR, für das dritte Kind 554 EUR-250 EUR/2 EUR sowie für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 554 EUR-250 EUR/2 EUR - Dritte Altersgruppe (12 bis 18 Jahre):
Für das erste und zweite Kind jeweils 649 EUR-250 EUR/2 EUR, für das dritte Kind 649 EUR-250 EUR/2 EUR sowie für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 649 EUR-250 EUR/2 EUR
Auch „privilegierte“ volljährige Kinder haben Anspruch auf Mindestunterhalt
§ 1612a BGB und die Mindestunterhaltsverordnung erwecken den Eindruck, dass nur minderjährige unverheiratete Kinder Anspruch auf Mindestkindesunterhalt haben. Das ist jedoch so nicht richtig. Den minderjährigen unverheirateten Kindern stehen volljährige unverheiratete Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gleich, solange sie im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden (sogenannte privilegierte Kinder). Damit haben also nicht nur minderjährige unverheiratete Kinder, sondern auch privilegierte volljährige Kinder Anspruch auf Mindestunterhalt.
Die Höhe dieses Mindestunterhalts ergibt sich aus der untersten Tabellengruppe der Düsseldorfer Tabelle. Auch hier ist aber das Kindergeld zu berücksichtigen, das nun nicht mehr an das betreuende Elternteil, sondern an das volljährige Kind ausgezahlt wird. Das Kindergeld mindert daher in voller Höhe den Bedarf des Volljährigen, so dass sich in dieser Höhe sein Anspruch auf Mindestkindesunterhalt verringert. Der Zahlbetrag für das privilegierte volljährige Kind ergibt sich ebenfalls aus dem "Anhang: Tabelle Zahlbeträge“ zur Düsseldorfer Tabelle.
Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen
Auch wenn der Barunterhaltspflichtige den Mindestunterhalt für die minderjährigen und diesen gleichgestellten privilegierten volljährigen Kinder an sich zu zahlen hat: Ihm selber muss so viel verbleiben, dass seine Existenz gesichert ist und er nicht selber bedürftig wird. Daher steht dem Unterhaltspflichtigen zur Abdeckung seines Existenzminimums gegenüber den minderjährigen und privilegierten volljährigen Kindern der notwendige Eigenbedarf zu. Dieser ist unantastbar und gegenüber den Unterhaltsverpflichtungen vorrangig. Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) beträgt gemäß Anmerkung 5. der Düsseldorfer Tabelle monatlich:
- 1.450 EUR, wenn der Unterhaltspflichtige erwerbstätig ist,
- 1.200 EUR, wenn der Unterhaltspflichtige nicht erwerbstätig ist.
Den Mindestunterhalt für Kinder zahlen kann der Pflichtige nur, wenn er leistungsfähig ist, also seine Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit oder Vermögen über dem notwendigen Eigenbedarf liegen. Ist der Pflichtige nicht leistungsfähig, kann er keinen Unterhalt zahlen und ist daher nicht unterhaltspflichtig.
Gesteigerte Erwerbsobliegenheit des Pflichtigen beim Mindestunterhalt für Kinder
Ist der Pflichtige mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig, muss er trotzdem alles in seinen Kräften Stehende unternehmen, um den Mindestkindesunterhalt sicherzustellen. Den Pflichtigen trifft insoweit eine gesteigerte Erwerbsobliegenheit (gesteigerte Erwerbspflicht, gesteigerte Unterhaltspflicht, gesteigerte Leistungsfähigkeit).
Was bedeutet „gesteigerte Erwerbsobliegenheit“?
Gesteigerte Erwerbsobliegenheit heißt, dass der Pflichtige zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, um den Mindestunterhalt für Kinder zahlen zu können. Diese Verpflichtung besteht solange, bis der Mindestkindesunterhalt gezahlt werden kann. Ist der Pflichtige zur Zahlung des Mindestunterhalts imstande, entfällt die gesteigerte Erwerbsobliegenheit.
Konkret hat die gesteigerte Erwerbsobliegenheit für den Unterhaltspflichtige zur Folge, dass er zur Abdeckung des Mindestunterhalts:
- seine Arbeitsstelle aufgeben und einen höher vergütete Beschäftigung wahrnehmen muss, notfalls auch in einem anderen Beruf als denjenigen, für den er ausgebildet wurde oder in dem er selbstständig tätig ist,
- eine zusätzliche Nebentätigkeit wie etwa einen Minijob auszuüben hat. Dabei muss allerdings eine Obergrenze gelten, so dass dem Pflichtigen nach den Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes wohl nicht mehr als 48 Arbeitsstunden wöchentlich zugemutet werden können.
- seine bisherige Arbeitsstelle behalten und seine Lebensplanung ändern muss, falls er eine schlechter vergütete selbstständige Tätigkeit aufnehmen möchte, in einer neuen Beziehung nur noch den Haushalt führen will oder eine Auswanderung bzw. einen längeren unbezahlten Aufenthalt im Ausland beabsichtigt.
Auch der Einwand des Unterhaltspflichtigen, er könne den Mindestunterhalt für Kinder aufgrund vorhandener Schulden oder seiner Fahrtkosten zur Arbeit nicht zahlen, greift nicht ohne weiteres.
Aufgrund seiner gesteigerten Erwerbsobliegenheit ist der Pflichtige vielmehr dazu angehalten, geringere monatliche Kreditraten zu beantragen, auch wenn der Kredit dadurch insgesamt teurer wird. Monatliche Darlehensraten bis 100 EUR bleiben selbst dann unberücksichtigt, wenn der notwendige Eigenbedarf dadurch angetastet wird. Sind gegen den Pflichtigen mehrere Pfändungen ausgebracht und kann er deswegen keinen Unterhalt zahlen, muss er regelmäßig den Weg der Privatinsolvenz beschreiten, um eine Vorrangigkeit der Unterhaltsforderung gegenüber den anderen Forderungen zu erreichen.
Die Strecken von und zur Arbeitsstelle hat der Pflichtige mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen, wenn das billiger als die Fahrten mit dem eigenen Pkw ist, auch wenn die Fahrtzeiten dadurch länger werden. Insoweit stellt sich bei einem teuren Pkw auch die Frage, ob dieser nicht verkauft und der Erlös zur Zahlung des Mindestunterhalts verwendet werden muss, da grundsätzlich auch vorhandenes Vermögen zur Mindestunterhaltssicherung einzusetzen ist.
Kommt der Unterhaltspflichtige seiner gesteigerten Erwerbsobliegenheit schuldhaft nicht nach, muss er sich so behandeln lassen, als ob er das ihm mögliche Einkommen erzielen würde. Das gilt erst recht, wenn der Pflichtige mutwillig seine Arbeitsstelle aufgibt. Damit wird dem Pflichtigen ein fiktives Einkommen unterstellt, welches das Familiengericht ihm in einem Unterhaltsrechtsstreit anrechnet. Aus dem Unterhaltstitel, also dem Beschluss des Familiengerichts, kann der Berechtigte dann notfalls gegen den Pflichtigen die Zwangsvollstreckung betreiben. Trägt der Pflichtige im Unterhaltsverfahren bei Gericht vor, er sei nicht leistungsfähig, ist er dafür darlegungs- und beweispflichtig. Pauschale Aussagen nach dem Motto „Ich habe nichts“ reichen den Familienrichtern nicht.
Wann entfällt die gesteigerte Erwerbsobliegenheit?
Die gesteigerte Erwerbsobliegenheit entfällt nicht nur bei Zahlung des Mindestunterhalts, sondern auch dann, wenn das Kind den Unterhalt aus seinem Vermögen bestreiten kann oder ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter vorhanden ist. Speziell letzterer Fall kann in der Praxis von Bedeutung sein. Denn als „unterhaltspflichtiger Verwandte“ kommt auch der andere Elternteil in Betracht, bei dem das minderjährige oder privilegierte volljährige Kind lebt.
Beim minderjährigen Kind besteht jedenfalls eine Verpflichtung zur Zahlung des Barunterhalts auch durch den betreuenden Elternteil, wenn dieser
- trotz der Betreuung des Kindes auch dessen Barunterhalt finanzieren kann,
- dabei den eigenen angemessenen Selbstbehalt nicht gefährdet und
- er das Dreifache des an sich barunterhaltspflichtigen Elternteils verdient.