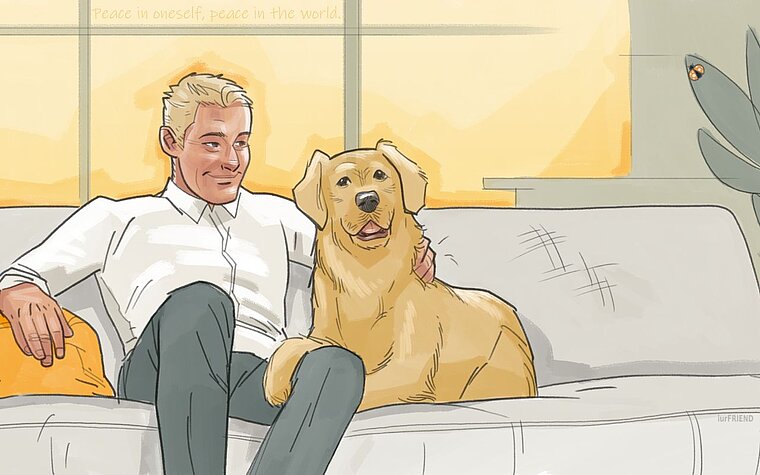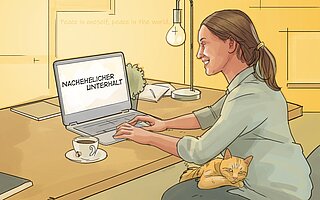Die gesetzliche Regelung zum Ehegattenunterhalt und seinen Grenzen
Als der Gesetzgeber mit Wirkung zum 01.01.2008 das Unterhaltsrecht reformierte, wollte er den bis dahin meist lebenslang bestehenden Anspruch auf Geschiedenenunterhalt an die gesellschaftlichen Veränderungen angleichen. Es wurde daher der Grundsatz der Eigenverantwortung aufgestellt, wonach die Ehegatten nach der Scheidung grundsätzlich selber für ihren Unterhalt sorgen müssen. Nur wenn das aus persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, kommt Geschiedenenunterhalt aufgrund einer der gesetzlichen Unterhaltstatbestände nach §§ 1570 ff BGB in Betracht.
Im Zuge der Reform wurde aber auch dieser noch mögliche Geschiedenenunterhalt als Folge des Grundsatzes der Eigenverantwortung beschränkt. Durch die Unterhaltsbegrenzung des geänderten § 1578b BGB wurde die Möglichkeit geschaffen, den nachehelichen Unterhalt herabzusetzen und / oder zeitlich zu befristen. Maßgebliches Kriterium für eine Begrenzung des Unterhalts ist die Prüfung, ob der Unterhaltsanspruch „unbillig“, also im Rechtssinne ungerecht, ist.
Vom Grundsatz der Eigenverantwortung machte der Gesetzgeber mit Wirkung zum 01.01.2013 einen kleinen Rückzieher, indem er in § 1578b BGB das Kriterium der langen Ehedauer einführte. Bei einer langen Ehedauer ist eine Unterhaltsbegrenzung nur schwer möglich. Hinzu kommt, dass eine lange Ehedauer auch häufiger zu einem Anspruch auf Unterhalt führt.
Herabsetzung und / oder zeitliche Befristung
Die Unterhaltsbegrenzung nach § 1578b BGB sieht insgesamt drei Möglichkeiten vor, den Geschiedenenunterhalt einzuschränken:
- Zunächst kann der nacheheliche Unterhalt auf den angemessenen Lebensbedarf herabgesetzt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der Geschiedenenunterhalt zunächst nach dem Maß der ehelichen Lebensverhältnisse bestimmt (voller Unterhalt). Die Unterhaltsbegrenzung erfolgt durch eine Herabsetzung auf den angemessenen Lebensbedarf, der sich nach der Lebensstellung richtet, die der Berechtigte ohne die Ehe und den damit verbundenen Erwerbsnachteilen erlangt hätte (Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 10.11.2010, Az. XII ZR 197/08).
- Alternativ kann eine Unterhaltsbegrenzung dergestalt erfolgen, dass der nacheheliche Unterhalt zeitlich befristet wird.
- Und schließlich ist eine Herabsetzung des Unterhalts in der Weise möglich, dass Herabsetzung und zeitliche Befristung miteinander kombiniert werden.
„Unbilligkeit“ als Kriterium der Herabsetzung des Unterhalts
Entscheidendes Kriterium für eine Unterhaltsbegrenzung ist die sogenannte Billigkeit. Dabei handelt es sich einfach nur um einen juristischen Begriff für Gerechtigkeit. Es unterliegt also – vereinfacht gesagt – einer Gerechtigkeitsprüfung des Familiengerichts, ob der Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung unbegrenzt besteht oder im Rahmen der Unterhaltsbegrenzung herabgesetzt und / oder zeitlich befristet wird. Das Gericht nimmt also eine Abwägung vor und schaut dabei zum einen auf die durch die Ehe entstandenen Nachteile für den Unterhaltsberechtigten (ehebedingte Nachteile), zum anderen auf die nacheheliche Solidarität.
Was sind „ehebedingte Nachteile“?
Die gesetzlichen Unterhaltstatbestände für den Geschiedenenunterhalt bezwecken in erster Linie einen Ausgleich der ehebedingten Nachteile des Unterhaltsberechtigten. Ehebedingte Nachteile sind solche, die zumindest teilweise ihre Ursache in der Eheschließung und der Rollenverteilung in der Ehe haben. § 1578b BGB nennt als mögliche Nachteile ausdrücklich die Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes sowie die Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe.
Wann überwiegen die „ehebedingten Nachteile“?
Zwei Ehen wurden geschieden. In beiden Fällen üben die vorher nicht berufstätigen Ehepartner inzwischen eine Erwerbstätigkeit aus und machen Unterhalt nach der Scheidung in Form von Aufstockungsunterhalt geltend. Ehepartner 1 (E1) hatte während der Ehe die berufliche Karriere zugunsten der Kinderbetreuung und Haushaltsführung aufgegeben. Demgegenüber kündigte Ehepartner 2 (E2) bereits geraume Zeit vor der Ehe die Arbeitsstelle wegen der Betreuung eines gemeinschaftlichen Kindes. Während der Ehe fand keine Betreuung des Kindes durch E2 statt, da das Kind auf ein Internat ging. Inzwischen sind die Kinder volljährig und stehen im Berufsleben. Folge: Bei E1 liegt in beruflicher Hinsicht ein ehebedingter Nachteil vor. Dagegen ist ein solcher Nachteil bei E2 nicht gegeben, da die Kindesbetreuung vor der Ehe stattfand und eine Kindesbetreuung während der Ehe nicht erfolgte (vgl. dazu BGH, Urteil vom 20.02.2013, Az.: XII ZR 148/10).
Für die Auswirkungen vorhandener bzw. nicht vorhandener ehebedingter Nachteile auf die Unterhaltsbegrenzung gilt also:
- Sind die ehebedingten Nachteile höher oder genauso hoch wie der errechnete nacheheliche Unterhalt, scheidet eine Unterhaltsbegrenzung in Form einer Herabsetzung oder zeitlichen Befristung regelmäßig aus.
- Sind die ehebedingten Nachteile niedriger als der errechnete Geschiedenenunterhalt, ist eine Unterhaltsbegrenzung dergestalt möglich, dass nur die ehebedingten Nachteile ausgeglichen werden, also eine Herabsetzung auf den angemessenen Unterhalt erfolgt, der nach dem Ausgleich der ehebedingten Nachteile verbleibt. Dagegen kommt eine zeitliche Befristung hier regelmäßig nicht in Betracht.
- Sind keine ehebedingten Nachteile vorhanden, ist eine Begrenzung des Unterhalts in Form der Herabsetzung und / oder zeitlichen Befristung möglich.
- Beim Betreuungsunterhalt, den der Berechtigte aufgrund der Betreuung eines Kindes erhält, ist keine zeitliche Befristung möglich, wohl aber eine Herabsetzung auf den angemessenen Lebensbedarf (BGH, Urteil vom 18.03.2009, Az.: XII ZR 74/08).
- Beim Altersunterhalt, Krankheitsunterhalt und Arbeitslosenunterhalt kann ausnahmsweise im Einzelfall eine Herabsetzung des Unterhalts ausgeschlossen sein.
Bei der Billigkeitsabwägung für eine Begrenzung des Unterhalts ist auch auf die nacheheliche Solidarität abzustellen. Eine genaue Definition für diesen Begriff existiert nicht. Gemeint ist damit die sogenannte wirtschaftliche Verflechtung der Ehegatten, die sich aus der Familieneinheit und der gegenseitigen Rücksichtnahme ergeben hat sowie speziell bei Ehen von längerer Dauer auch nach der Scheidung noch fortwirkt.
Wird etwa ein lebenslanger Anspruch auf nachehelichen Unterhalt geltend gemacht, bei dem eine Herabsetzung des Unterhalts ausscheiden soll, spielt bei der Billigkeitsabwägung auch die nacheheliche Solidarität eine Rolle (vgl. dazu BGH, Urteil vom 08.06.2011, Az.: XII ZR 17/09).
Wie eine Unterhaltsbegrenzung durchzusetzen ist
Möchte der Pflichtige eine Begrenzung des Unterhalts durchsetzen, muss er sich dazu an das Familiengericht wenden. Geltend gemacht wird die Begrenzung des Unterhalts in der Praxis meistens im Rahmen einer Abänderungsklage, also wenn der bereits vor einiger Zeit ergangene gerichtliche Beschluss über den Unterhaltsanspruch abgeändert werden soll, weil sich die zugrundeliegenden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Die meisten gerichtlichen Verfahren wegen einer Unterhaltsbegrenzung betreffen den Aufstockungsunterhalt.
Einwand der Unterhaltsbegrenzung sofort geltend machen
Der Unterhaltspflichtige sollte bereits im ersten Gerichtsverfahren, in dem der Berechtigte Unterhalt nach der Scheidung beansprucht, den Einwand der Unterhaltsbegrenzung geltend machen und diesen ausreichend begründen. Geschieht das nicht und war bereits zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit vorhersehbar, dass Gründe für eine Begrenzung des Unterhalts in Form einer Herabsetzung oder zeitlichen Befristung vorliegen, kann deswegen die Unterhaltsbegrenzung in einem späteren Abänderungsverfahren abgelehnt werden. Denn im Abänderungsverfahren können Fehler aus dem ersten Verfahren nicht korrigiert werden.
Beweispflichtig für Tatsachen, die die Begrenzung des Unterhalts begründen, ist der unterhaltspflichtige geschiedene Ehegatte. Allzu hohe Anforderungen werden daran aber nicht gestellt. Es reicht daher aus, wenn der Pflichtige im Gerichtsverfahren etwa Folgendes vorträgt:
Der geschiedene unterhaltsberechtigte Ehegatte (bzw. Antragsteller oder Antragsgegner) betreut keine Kinder mehr und kann einer Vollzeitbeschäftigung im erlernten oder vor der Ehe ausgeübten Beruf nachgehen. Im Übrigen sind keine ehebedingten Nachteile ersichtlich. Es ist dann Sache des Berechtigten, die Umstände darzulegen und unter Beweis zu stellen, die eine Herabsetzung des Unterhalts ausschließen. Um dieser sekundären Beweislast nachzukommen, kann sich der Berechtigte – in dem Fall, in dem er wegen der Ehe und Kinderbetreuung seine berufliche Karriere aufgegeben hat – etwa vergleichbarer Karriereverläufe bedienen, um seine damaligen beruflichen Möglichkeiten plausibel vorzutragen (BGH, Beschluss vom 14.05.2014, Az.: XII ZB 301/12).
Wann die Unterhaltsbegrenzung eingreift und der Geschiedenenunterhalt beschränkt wird
Liegen die Voraussetzungen für eine Unterhaltsbegrenzung vor, stellt sich die Frage, wann genau diese konkret eingreift und ab wann genau der nacheheliche Unterhalt herabgesetzt und / oder zeitlich befristet wird. Hier kann ein Anwalt für Familienrecht Ihnen nur eine erste Einschätzung geben.
Im Ergebnis entscheidet aber das Familiengericht nach einer Billigkeitsabwägung aller Umstände (BGH, Beschluss vom 14.05.2014, Az.: XII ZB 301/12). Wie lange dann noch der Anspruch auf vollen Unterhalt nach der Scheidung besteht und wann die Begrenzung des Unterhalts zum Tragen kommt, befindet einzig und allein das Gericht.
Schuldhaftes Fehlverhalten und ähnliche Gründe
Neben der Begrenzung des Unterhalts für den Geschiedenenunterhalt nach § 1578b BGB „Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhalts wegen Unbilligkeit“ gibt es noch die
- Unterhaltsbegrenzung für den Ehegattenunterhalt (Trennungsunterhalt und nachehelicher Unterhalt) nach 1579 BGB „Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen grober Unbilligkeit"
- Begrenzung für den Unterhalt von Verwandten in gerader Linie, wozu insbesondere der Kindesunterhalt gehört, nach § 1611 BGB „Beschränkung oder Wegfall der Verpflichtung“
Gemeinsam haben beiden Vorschriften, dass es bei grober Unbilligkeit zu Wegfall und Minderung des Unterhalts kommen kann, also eine Verwirkung, Kürzung oder Befristung des Unterhaltsanspruchs möglich ist. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Fälle, in denen der Unterhaltsberechtigte schuldhaft Straftaten oder schwere Fehlverhalten gegenüber dem Unterhaltspflichtigen begeht.