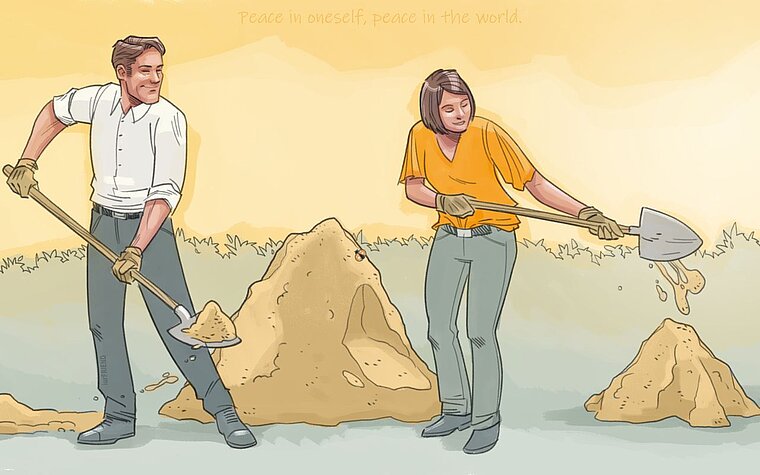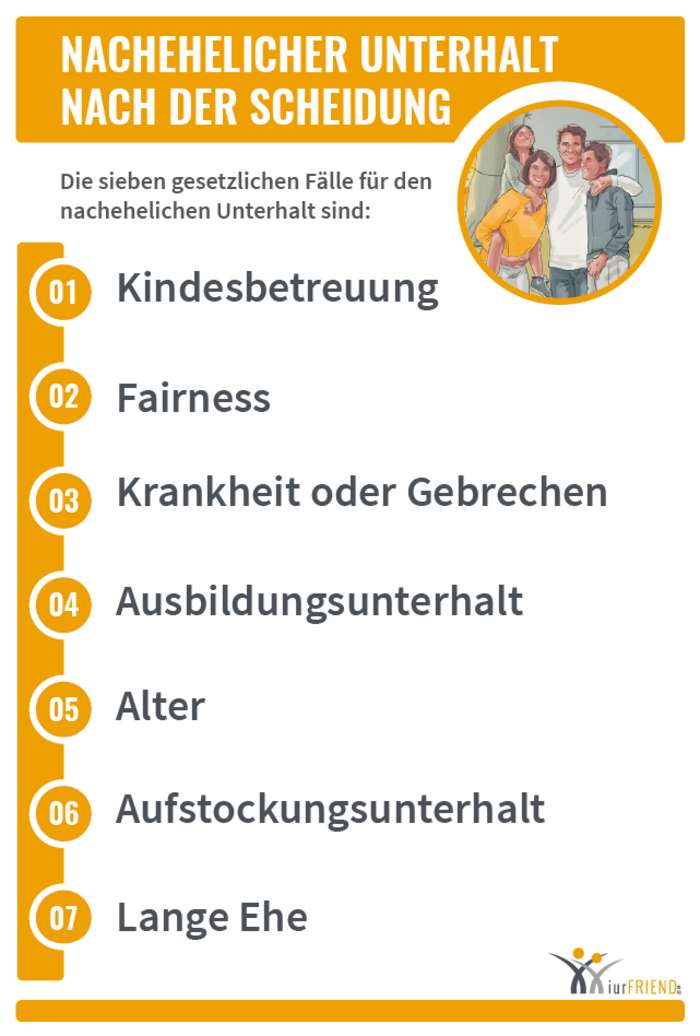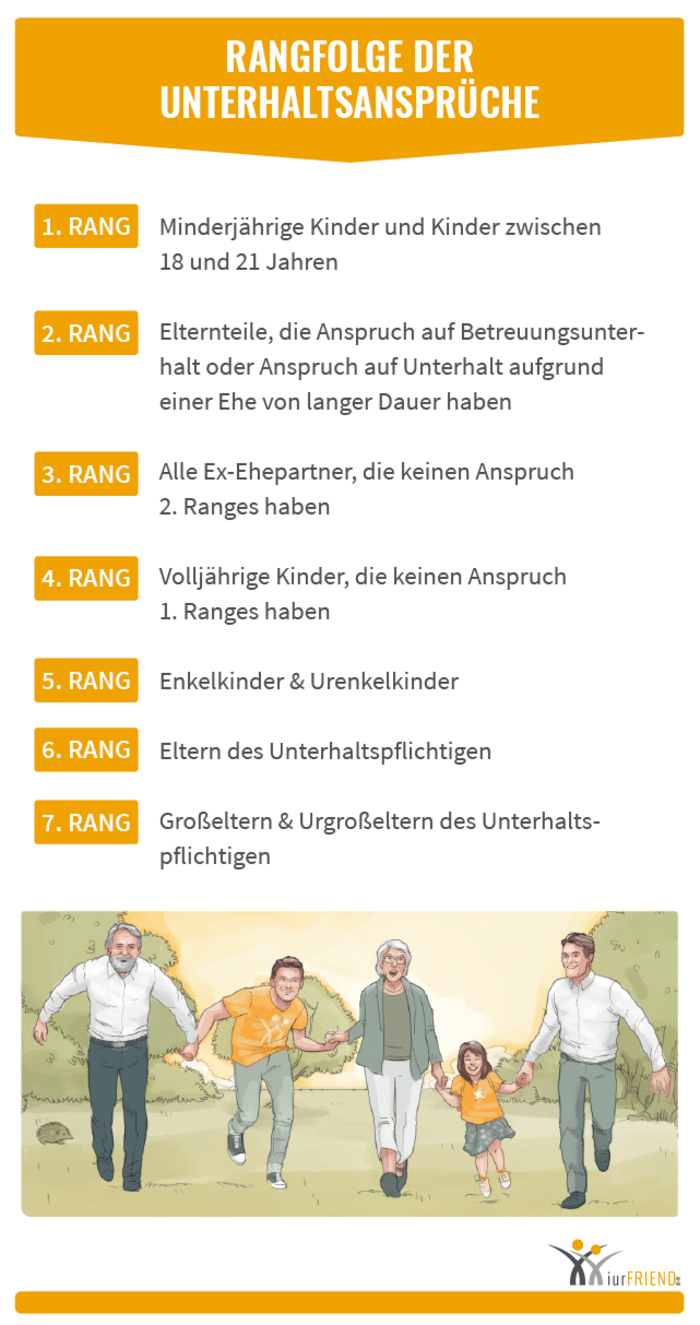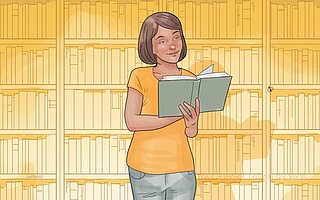Bedürftigkeit bei Unterhaltszahlung
Bedürftigkeit im Sinne des Unterhaltsrechts ist stets vorhanden, wenn der Berechtigte seinen Lebensunterhalt aus eigenem Erwerbseinkommen, Vermögenseinkünften oder seinem Vermögen nicht finanzieren kann. Die Bedürftigkeit besteht aber nur in der Höhe, in der der Bedarf des Berechtigten nicht gedeckt ist. Reichen die eigenen Einkünfte des Berechtigten also dafür aus, einen Teil seines Bedarfs selber abzudecken, ist er in dieser Höhe nicht bedürftig. Dazu sollten Sie Folgendes wissen:
Speziell unverheiratete minderjährige Kinder sind mangels eigenen Einkommens oder eigenen Vermögens in Bezug auf Unterhaltszahlung immer bedürftig. Daher haben sie Anspruch auf Kindesunterhalt, wobei die Bedürftigkeit von minderjährigen Kindern ausdrücklich in § 1602 Abs. 2 BGB geregelt ist. Den unverheirateten minderjährigen Kindern sind die sogenannten privilegierten volljährigen Kinder (unverheiratet, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils lebend und in der allgemeinen Schulausbildung) gleichgestellt.
Bei sonstigen volljährigen Kindern, insbesondere auswärts lebenden Studenten oder Kindern mit eigenem Hausstand, kommt es weniger auf deren Bedürftigkeit als vielmehr auf die Leistungsfähigkeit der Eltern an. Grundsätzlich schulden die Eltern den Kindern jedoch eine angemessene Ausbildung.
Fiktive Einkünfte und anderes Einkommen
Zunächst besteht für den Berechtigten die Verpflichtung, seinen Bedarf möglichst niedrig zu halten, um den Unterhaltspflichtigen nicht unnötig mit Unterhaltsansprüchen zu belasten. Unterlässt der Bedürftige es, zumutbare Einkünfte zu erzielen (etwa mutwillige Kündigung einer Teilzeitbeschäftigung), hat er sich so behandeln zu lassen, als würde er diese Einkünfte weiterhin bzw. tatsächlich erhalten. Dieser mögliche, aber unterlassene Verdienst kann dem Berechtigten daher fiktiv angerechnet werden.
Umgekehrt kann es aber auch vorkommen, dass der Berechtigte mehr arbeitet als er müsste. So ist etwa eine Mutter, die ein aus der Ehe stammendes Kleinkind betreut, zur Ausübung eines Mini-Jobs nicht verpflichtet. Geht sie einer solchen geringfügig entlohnten Beschäftigung trotzdem nach, ist die Frage, wie das überobligationsmäßig erzielte Erwerbseinkommen auf ihren Bedarf bei der Unterhaltszahlung anzurechnen ist. Zwar ist ein solches Einkommen an sich nicht zu berücksichtigen. In der Praxis wird dieser Verdienst jedoch – nach Abzug der anteiligen berufsbedingten Aufwendungen – meistens zur Hälfte auf den Bedarf angerechnet.
Hat der Berechtigte Einkünfte aus Vermögen (etwa Zins- oder Kapitalerträge), mindern diese seinen Bedarf und sind daher anzurechnen. Dies gilt auch bei Mieteinnahmen aus einer Immobilie, deren Eigentümer er ist und die von ihm nicht bewohnt wird. Hier ist allerdings – wie auch bei anderen vermögensbildenden Maßnahmen – zu berücksichtigen, dass die Schuldzinsen für die Immobiliendarlehen von den Mieteinahmen abgezogen werden dürfen, während die Tilgungszahlungen auf diese Darlehen unberücksichtigt bleiben.
Lebt der Berechtigte hingegen mietfrei in der eigenen Immobilie, muss er sich einen sogenannten Wohnvorteil anrechnen lassen, der seinen Bedarf mindert. Dabei gelten je nach Art und Dauer des Unterhalts verschiedene Berechnungsweisen für den Wohnvorteil. So müssen sich Berechtigte beim Trennungsunterhalt im ersten Jahr als Wohnvorteil grundsätzlich nur das anrechnen lassen, was eine kleinere, günstigere Wohnung auf dem örtlichen Wohnungsmarkt an Miete kostet. Danach und beim nachehelichen Unterhalt ist regelmäßig das als Wohnvorteil zu berücksichtigen, was sich mit der Vermietung des abbezahlten Eigenheims erzielen lassen würde. Daneben bestehen weitere Besonderheiten, etwa wenn die Immobilie noch nicht vollständig bezahlt ist.
Schließlich kann der Ehegattenunterhalt wegen grober Unbilligkeit beschränkt oder versagt werden. Der typische Fall ist, dass sich der getrenntlebende oder geschiedene Ehepartner in einer verfestigten neuen Lebensgemeinschaft befindet. Hier wird der Bedarf des Bedürftigen durch die gemeinsame Wirtschaftsführung in der neuen Beziehung regelmäßig gemindert. In der Praxis besteht jedoch häufig das Problem, die „Verfestigung“ der Lebensgemeinschaft nachzuweisen.
Leistungsfähigkeit bei Unterhaltszahlung
Unterhalt zahlen kann nur derjenige, der leistungsfähig ist. Das setzt voraus, dass das Einkommen des Pflichtigen aus Erwerb und Vermögen zur Abdeckung der Unterhaltsansprüche der Berechtigten ausreicht. Dabei muss dem Pflichtigen allerdings so viel verbleiben, dass sein eigener Lebensunterhalt nicht gefährdet ist. Bei der Ermittlung der Leistungsfähigkeit bzw. der erzielten Einkünfte ist Folgendes für Sie wichtig:
Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit
Bezieht der Pflichtige Entgelt aus einem Arbeits- oder Angestelltenverhältnis, werden für die Ermittlung seiner Leistungsfähigkeit bei der Unterhaltszahlung die Brutto-Einkünfte der letzten 12 Monate und der letzte Einkommensteuerbescheid zugrundegelegt. Dazu gehören auch Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, branchen- oder berufsübliche Überstunden sowie ca. 1/3 der erstatteten Spesen und Auslagen, zudem auch geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers (etwa vergünstigte Waren oder eine Wohnung). Auch ein etwaiger Dienstwagen ist in Höhe der steuerlichen Vorteile einzubeziehen, das heißt entweder nach der sogenannten 1%-Regelung oder nach der Fahrtenbuchmethode.
Ist das Bruttoeinkommen ermittelt, sind davon die Steuern, Sozialabgaben und zum Teil die Altersvorsorgeaufwendungen abzuziehen. Das sich daraus ergebende Nettoeinkommen ist um grundsätzlich 5% berufsbedingte Aufwendungen sowie ggf. vorhandene berücksichtigungsfähige Schulden zu bereinigen. Ist dies geschehen und sind sonstige Besonderheiten sowie etwaige weitere Einkünfte aus anderen Einkommensarten berücksichtigt, lässt sich das monatliche Einkommen bestimmen, das für den Unterhalt zur Verfügung steht.
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
Ist der Pflichtige selbstständig, sind für die Bestimmung seines unterhaltsrelevanten Einkommens seine Bilanzen bzw. Einnahmen-/Überschussrechnungen und Steuerbescheide der letzten drei Jahre maßgeblich. Steuerliche Abschreibungen sind dabei in den meisten Fällen für das unterhaltsrechtliche Einkommen nicht zu berücksichtigen. Ebenso wird das Einkommen nicht um berufsbedingte Aufwendungen bereinigt, da diese Aufwendungen bereits bei den Betriebsausgaben berücksichtigt sind. Dagegen sind berücksichtigungsfähige Schulden, die etwa aus der Ehe stammen, in Abzug zu bringen. Daraus und aus etwaigen anderen Einkommensarten lässt sich das monatliche Einkommen des Selbstständigen ermitteln.
Eigenbedarf: Was dem Pflichtigen als Existenzminimum verbleiben muss
Ist das Einkommen des Pflichtigen ermittelt, ist zu prüfen, ob er leistungsfähig ist. Hierzu sollten Sie darüber informiert sein, dass dem Pflichtigen zur Sicherung seines eigenen Lebensbedarfs ein unantastbares Existenzminimum (Eigenbedarf) verbleiben muss. Dieser Eigenbedarf steht für die Unterhaltszahlung nicht zur Verfügung, damit der Pflichtige nicht selber bedürftig wird. Im Einzelnen darf der Pflichtige nach den Anmerkungen zur Düsseldorfer Tabelle monatlich folgende Netto-Beträge behalten:
- Notwendiger Eigenbedarf (Selbstbehalt) gegenüber minderjährigen und privilegierten Kindern
Der notwendige Eigenbedarf steht dem Pflichtigen gegenüber seinen minderjährigen unverheirateten Kindern und volljährigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zu, die im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden (sogenannte privilegierte volljährige Kinder nach § 1603 Abs. 2 BGB). Dabei ist zu unterscheiden, ob der Pflichtige einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder nicht. Ist er erwerbstätig, beläuft sich sein Selbstbehalt auf 1.450 EUR. Ist er nicht erwerbstätig, reduziert sich der Selbstbehalt auf 1.200 EUR. - Angemessener Eigenbedarf gegenüber den anderen volljährigen Kindern
Der angemessene Eigenbedarf besteht gegenüber den anderen volljährigen Kindern, also den nicht privilegierten Kindern, wie etwa dem auswärts wohnenden Studenten. Der angemessene Eigenbedarf wird mit mindestens 1.750 EUR angesetzt. Ob der Pflichtige erwerbstätig ist oder nicht, ist dabei bedeutungslos. - Monatlicher Eigenbedarf (Selbstbehalt) gegenüber dem Ehegatten
Der monatliche Eigenbedarf kommt gegenüber dem getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten zum Tragen. Dieser Selbstbehalt wird mit 1.600 EUR beziffert. Auch hier spielt es keine Rolle, ob der Pflichtige einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder nicht.