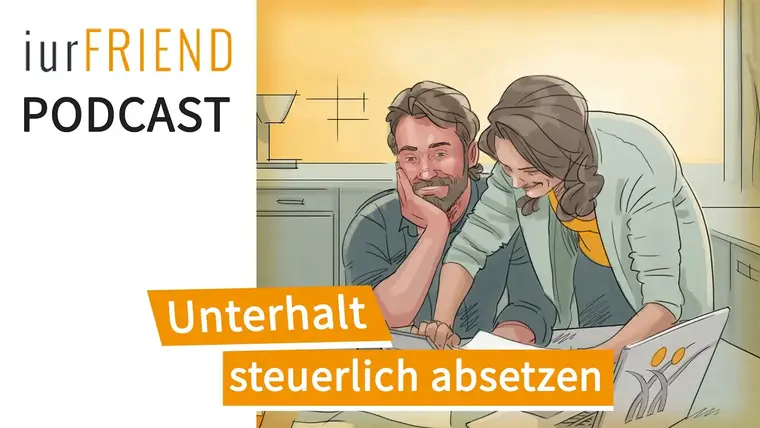Wer zahlt die Pflegeheimkosten, wenn die Rente der Eltern nicht ausreicht?
Muss ein Elternteil ins Pflegeheim oder ins Altersheim, mussten Sie statistisch betrachtet im Jahr 2019 im bundesweiten Durchschnitt mit etwa 1.830 EUR Kosten rechnen, die der Elternteil selbst tragen musste. Die Prüfung, wer die Pflegeheimkosten zahlt, durchläuft folgende Prüfungsschritte:
- Benötigt Ihr Elternteil Pflege und wird in einem Pflege- oder Altenheim untergebracht, hat der Elternteil wegen seiner Pflegebedürftigkeit meist auch einen Pflegegrad. Mit dem Geld aus der Pflegekasse können die Pflegeheimkosten ansatzweise abgedeckt werden. Je nach Einstufung in einen Pflegegrad trägt die Pflegekasse/Pflegeversicherung einen Teil der Pflegekosten. In Abhängigkeit vom Maß der Beeinträchtigung werden Pflegegrade von 1 - 5 vergeben. Den Pflegegrad ermitteln Gutachter der Pflegeversicherung nach Maßgabe der körperlichen, psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen der pflegebedürftigen Person.
Betreutes Wohnen als Alternative
Als Alternative für die Unterbringung in einem Pflegeheim könnte bei einem Pflegegrad 2 oder 3 auch die Pflege und Betreuung in einer ambulant betreuten Wohngruppe oder Seniorenwohngemeinschaft eine sinnvolle Alternative darstellen. Dabei wird die pflegerische Versorgung gemeinschaftlich organisiert. Die Kosten für Miete und Verpflegung tragen die WG-Bewohner selbst. Die Pflegeleistungen werden allerdings gefördert. Die Pflegekassen vergeben einen Gründungszuschuss von 2.500 EUR je Wohngruppenmitglied für maximal vier Bewohner und monatliche Wohngruppenzuschüsse von derzeit ca. 214 EUR. Außerdem werden Maßnahmen zum altersgerechten Wohnraumumbau mit bis zu 4.000 EUR je Maßnahme und insgesamt maximal 16.000 EUR für die gesamte WG gewährt. Kommt die Unterbringung in einer Senioren-WG nicht in Betracht, bleibt nur die Unterbringung im Seniorenheim oder einem Pflegeheim. Trägt der Sozialhilfeträger die Unterbringungskosten, schuldet er nur die Unterbringung in einem einfachen und kostengünstigen Pflegeheim (BGH, Urteil vom 7.10.2015, Az. XII ZB 26/15). Stehen mehrere Heime zur Wahl, hat der Elternteil ein Mitspracherecht.
- Die restlichen Kosten, die die Pflegekasse nicht übernimmt, trägt der Elternteil. Dazu muss der Elternteil seine Rente, Mieteinnahmen, Kapitalerträge einsetzen und eventuell vorhandene Vermögenswerte verwerten. Hat der Elternteil nicht genügend Einkünfte, hat er oder sie Anspruch auf Grundsicherung im Alter, wenn der Elternteil das Eintrittsalter der Regelaltersgrenze erreicht hat. Zudem besteht Anspruch auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung, wenn er oder sie vor Vollendung des 65. Lebensjahres aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung dauerhaft voll erwerbsgemindert ist.
- Reichen die Einkünfte des Elternteils nicht aus, ist prüfen, ob der Ehepartner zur Zahlung der restlichen Pflegeheimkosten herangezogen werden kann.
- Kann auch der Ehepartner keinen Kostenbeitrag leisten, kommt das Sozialamt in Form von „Hilfe zur Pflege“ für die Pflegeheimkosten auf.
- Hat das Sozialamt Erkenntnisse, dass Sie als Kind des pflegebedürftigen Elternteils mehr als 100.000 EUR brutto im Jahr verdienen, müssen Sie Angaben zu Ihrem Einkommen machen. Als Kind sind Sie gegenüber dem pflegebedürftigen Elternteil unterhaltspflichtig und müssen Elternunterhalt zahlen, wenn Ihr „bereinigtes Nettoeinkommen“ die Grenze von 100.000 EUR übersteigt. Dabei sind Freibeträge, Selbstbehalte und Schonvermögen zu berücksichtigen. Sind Sie verheiratet, wird auch das Einkommen Ihres Ehepartners als Familieneinkommen berücksichtigt.
Inwieweit müssen Kinder für Eltern im Pflegeheim / Altersheim zahlen?
Als Kind sind Sie mit Ihren Eltern in direkter Linie verwandt. Sie sind Blutsverwandte. Blutsverwandte sind, wenn ein Verwandter unterhaltsbedürftig ist, einander unterhaltspflichtig. Als Kind schulden Sie Ihren Elternteilen also Elternunterhalt (§ 1601 BGB).
Da die Pflegekosten bei der Heimunterbringung aber exorbitante Ausmaße angenommen haben, ist beim Gesetzgeber die Erkenntnis gereift, dass Kinder finanziell nicht überlastet werden dürfen. Müssten Sie als Kind in vollem Umfang für die Unterbringungskosten im Pflegeheim aufkommen, wäre möglicherweise Ihr eigener Lebensunterhalt gefährdet. Auch die Altersvorsorge wäre nicht mehr gewährleistet. Deshalb hat der Gesetzgeber mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz Abhilfe geschaffen.
Das Angehörigen-Entlastungsgesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Es betrifft lediglich Kinder und Elternteile, nicht aber Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner. Danach brauchen unterhaltspflichtige Kinder ihren Eltern erst dann Elternunterhalt zu zahlen, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 EUR übersteigt.
Haben Sie mehrere Geschwister und verdienen mehr als 100.000 EUR, haften Sie nicht allein für den gesamten Kostenaufwand der Pflege Ihres Elternteils. Sie brauchen den Anteil Ihrer Geschwister nicht mitzutragen, wenn diese weniger als 100.000 EUR verdienen. Sie haften nur für Ihren eigenen Anteil. Verdienen Sie mehr als 100.000 EUR unterhaltsrelevantes Einkommen, wäre es nicht zu beanstanden, wenn Sie künftig weniger arbeiten und so nicht zum Elternunterhalt herangezogen werden können. Das Sozialamt dürfte Ihnen dann nicht einfach ein theoretisch weiterhin erzielbares Gehalt unterstellen.
Wie wird der Elternunterhalt berechnet?
Kommen Sie für den Elternunterhalt in Betracht, müssen Sie gegenüber dem Sozialamt Ihr Einkommen offenlegen. Zu Ihrem Einkommen zählt Ihr Bruttolohn. Außerdem sind Mieteinnahmen und Kapitalerträge zu berücksichtigen. Ihr Bruttoeinkommen ist jedoch um eine Reihe von Kosten zu reduzieren. Ihr danach bereinigtes Nettoeinkommen ergibt sich im Regelfall aus Ihrem Einkommensteuerbescheid. Sind Sie selbstständig tätig, dürfen Sie entsprechende Betriebskosten berücksichtigen. Im Ergebnis zählt auch hier Ihr Einkommensteuerbescheid.
Ihre Einnahmen vermindern sich um bestimmte Verbindlichkeiten. So dürfen Sie Ihre Darlehensverbindlichkeiten für Ihre kreditfinanzierte Wohnung sowie private Altersvorsorgekosten bis zu 5 % Ihres Bruttoeinkommens berücksichtigen. Für Reparaturen am Haus, für Urlaubsreisen oder die Ausbildung Ihrer Kinder dürfen Sie finanzielle Rücklagen bilden. Gegenüber dem Sozialamt wäre zu erklären, in welcher Höhe Sie Geld zurückgelegt haben und für welchen Zweck Sie Geld ansparen. Insoweit stehen Ihnen Schonbeträge zu. Feste Schonbeträge gibt es aber nicht (BGH Az. XII ZB 269/12). Zu berücksichtigen sind auch Ihre Unterhaltszahlungen gegenüber einem geschiedenen Ehepartner sowie Ihren Kindern aus einer früheren Ehe.
Auskunftspflicht der Kinder
Nach dem Gesetz wird vermutet, dass Ihr Einkommen 100.000 EUR brutto im Jahr nicht überschreitet. Hat das Sozialamt jedoch Anhaltspunkte, dass Sie mehr verdienen, sind Sie verpflichtet, Angaben zu Ihrem Einkommen zu machen. Solange das Sozialamt aber keine derartigen Anhaltspunkte hat, darf es nur den bedürftigen Elternteil zu den Einkommensverhältnissen der Kinder befragen (§ 94 Abs. 1a S. 4 SGB XII). Dies führt zu der wenig verständlichen Konsequenz, dass das Kind eines dementen oder desorientierten Elternteils, der keine Auskünfte geben kann, begünstigt wird, weil das Sozialamt mangels entsprechender Ansätze die gesetzliche Vermutung nicht widerlegen kann. Ob Sozialämter dann trotzdem eigenständig Recherchen anstellen, bleibt abzuwarten.
Berücksichtigung von Vermögenswerten
Ihr Vermögen zählt nicht. So kann es vorkommen, dass Sie unter der Einkommensgrenze liegen, aber hohe Vermögenswerte besitzen. Sie brauchen dann keinen Elternunterhalt zu zahlen, während ein Kind, das keinerlei Vermögenswerte besitzt, aber über der Einkommensgrenze liegt, Elternunterhalt zahlen muss. Das Risiko, dass das Sozialamt aber auf Ihre Vermögenswerte zugreift, ist erfahrungsgemäß gering, weil Ihre selbstbewohnte Immobilie oder Ihre Altersvorsorgevermögen sozialrechtlich als Schonvermögen gelten und für das Sozialamt damit unantastbar bleiben.
Kredite für Eigenheimfinanzierung berücksichtigen
Haben Sie den Kaufpreis für Ihr Eigenheim finanziert, dürfen Sie sowohl die Zins- als auch die Tilgungsleistungen für den Bankkredit berücksichtigen. Die Bankfinanzierung einer selbstgenutzten Immobilie diene nämlich dem Grundbedürfnis der Familie und mindere das unterhaltsrelevante Einkommen. Sie dürfen also keinesfalls veranlasst werden, Ihr selbstgenutzten Eigenheim zu verkaufen (BGH, Beschluss vom 9.3.2016, Az. XII ZB 693/14). Da das Wohnen im eigenen Haus auch der eigenen Altersversorgung diene, geht der dafür notwendige Aufwand der Sorge für einen unterhaltsbedürftigen Elternteil vor. Tilgungsleistungen werden aber nur bis zur Höhe des Wohnvorteils berücksichtigt, den Sie als ersparte Miete für eine vergleichbare Wohnung zahlen müssten.
Selbstbehalt bei Elternunterhalt
Liegt Ihr Einkommen über 100.000 EUR im Jahr und steht Ihr unterhaltsrelevantes Nettoeinkommen fest, haben Sie noch immer Anspruch auf 2.000 EUR EUR Selbstbehalt. Der Selbstbehalt erhöht sich auf 3.600 EUR EUR, wenn Sie verheiratet sind. Leben Sie nur in einer Lebensgemeinschaft zusammen, steht Ihnen der Familienselbstbehalt nicht zu. Nur das Einkommen, das über Ihre Selbstbehalte hinausgeht, kommt dann für den Unterhalt Ihres pflegebedürftigen Elternteils in Betracht. Nur insoweit können Sie vom Sozialamt in Regress genommen werden.
Elternunterhalt berechnen
Sie sind verheiratet und verdienen 105.000 EUR brutto. Es ergibt sich nach Abzug aller relevanten Verbindlichkeiten ein unterhaltsrelevantes Nettoeinkommen von 4.800 EUR im Monat. Abzüglich Ihres Selbstbehalts von 3.600 EUR verbleiben ###ERG### EUR als unterhaltsrelevantes Einkommen. Davon müssten Sie die Hälfte 2, also ###ERG### EUR, als Elternunterhalt für Ihren pflegebedürftigen Elternteil verwenden und dem Sozialamt insoweit den Kostenaufwand erstatten.
Die Einkommensgrenze ist eine starre Grenze. Verdienen Sie genau 100.000 EUR, brauchen Sie keinen Elternunterhalt zu zahlen. Verdienen Sie unter Berücksichtigung Ihrer Selbstbehalte und Ihres Schonvermögens jedoch 100.000 EUR+0,01 EUR, werden Sie unterhaltspflichtig. Inwieweit diese offensichtliche Ungleichbehandlung verfassungskonform ist, bleibt abzuwarten. Sollten Sie betroffen sein, ist dringend anzuraten, sich anwaltlich beraten zu lassen. Schließlich ist es so, dass die Absicht des Gesetzgebers, Familien zu entlasten, ins Gegenteil verkehrt wird, wenn bereits ein geringfügiger Betrag dazu führt, dass Sie unterhaltspflichtig werden und Sie insoweit stärker belastet werden als eine Person, die knapp unterhalb der Einkommensgrenze verdient.
Inwieweit ist das Einkommen des Elternteil-Ehepartners zu berücksichtigen?
Ist der pflegebedürftige Elternteil noch verheiratet, steht auch der Ehepartner finanziell in der Verantwortung. Sein Einkommen ist durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz nicht geschützt. Die finanzielle Situation des Ehepartners ist bei der Frage der Bedürftigkeit zu berücksichtigen. Ihren beiden Eltern stehen insgesamt 10.000 EUR als Schonbetrag zu. Einkommen und Vermögenswerte, die diesen Betrag übersteigen, müssen für den Unterhalt des pflegebedürftigen Elternteils verwendet werden.
Sind auch Schwiegerkinder unterhaltspflichtig?
Verdienen Sie als Schwiegerkind mehr als 100.000 EUR im Jahr, brauchen Sie für Ihren Schwiegerelternteil keinen Unterhalt zu zahlen und werden auch vom Sozialhilfeträger nicht in Anspruch genommen. Als Schwiegerkind sind Sie nämlich nicht gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet. Schließlich sind Sie mit Ihren Schwiegereltern nicht verwandt. Es kann aber sein, dass Ihr Einkommen bei der Berechnung des Familienbedarfs berücksichtigt wird und es dadurch zu Ihrer indirekten Haftung als Schwiegerkind kommt (BGH Az. XII ZB 25/13).
Was ist, wenn Sie keinen Kontakt zu Ihrem Elternteil haben?
Auch wenn Sie keinen Kontakt zu Ihrem Elternteil haben, stehen Sie als direkter Verwandter in der Unterhaltspflicht. Der Bundesgerichtshof hatte einen Sohn zum Unterhalt für sein Vater verpflichtet, obwohl der Vater den Kontakt in jungen Jahren abgebrochen hatte (BGH Az. XII ZB 607/12). Allenfalls dann, wenn Sie dem Elternteil ein „sittliches Verschulden“ nachweisen können, ist die Befreiung vom Elternunterhalt eine Option (§ 1611 BGB). In Betracht kommen folgende Sachverhalte:
- Ihr Elternteil hat seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie und Ihrer Person grob und nachhaltig vernachlässigt.
- Ihr Elternteil hat seine Bedürftigkeit durch Spiel-, Alkohol- oder Drogensucht selbst herbeigeführt. Da eine Sucht aber als Krankheit zählt, kommt die Sucht nur als ein sittliches Verschulden in Betracht, wenn der Elternteil in vorwerfbarer Art und Weise die Sucht verursacht hat und nichts dagegen unternimmt.
- Ihr Elternteil hat sich einer schweren Verfehlung schuldig gemacht. Dabei geht es meist um Fälle des sexuellen Missbrauchs oder bewusst falsche Strafanzeigen.
Podcast
Unterhalt von der Steuer absetzen? So geht's!
Ist Elternunterhalt steuerlich absetzbar?
Sind Sie zum Elternunterhalt verpflichtet, können Sie die Beträge steuerlich als außergewöhnliche Belastungen in Ihrer Einkommensteuererklärung bis maximal 12.096 EUR im Jahr geltend machen. Bezieht Ihr Elternteil eine Rente, wird jeder Betrag über 624 EUR von der Summe Ihrer steuerlich relevanten Zahlungen abgezogen. Der Höchstbetrag gilt dabei nicht pauschal für das ganze Jahr, sondern kommt nur anteilig für den Zeitraum in Anrechnung, in denen Sie Zahlungen geleistet haben. Möchten Sie Ihre Unterhaltszahlungen steuerlich geltend machen, müssen Sie die Anlage Unterhalt „Unterhaltsleistungen für bedürftige Angehörige“ verwenden und Ihrer Einkommensteuererklärung beifügen.