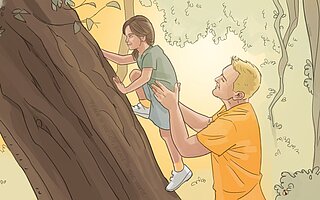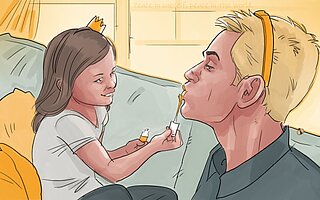Welche Rechte und Pflichten ergeben sich im Hinblick auf das Kind nach der Scheidung?
Trennen Sie sich von Ihrem Ehepartner und lassen sich scheiden, besteht trotz Trennung und Scheidung das gemeinsame Sorgerecht fort. Die Scheidung ändert nichts an der gemeinsamen Verantwortung für Ihr gemeinsames Kind. Dem nicht betreuenden Elternteil steht über das Sorgerecht hinaus ein Umgangsrecht mit dem Kind zu. Wer das Kind nicht selbst in seinem Haushalt betreut, zahlt für das Kind Kindesunterhalt.
Derjenige Elternteil, der das Kind in seinem Haushalt betreut und mit Kost und Logis unterhält, erfüllt allein mit der Betreuung seine Unterhaltspflicht. Dieser Betreuungsunterhalt ist dem Barunterhalt, den der nicht betreuende Elternteil in Form von Bargeld leistet, absolut gleichwertig.
Wer Kindesunterhalt als Barunterhalt zahlt, hat kein Recht, den Kindesunterhalt allein deshalb kürzen zu wollen, weil er sich in besonderer Weise um das Kind sorgt, ihm Kleidung kauft oder sonstige Vergünstigungen oder finanzielle Leistungen zukommen lässt. Entscheidend ist allein der nach der Düsseldorfer Tabelle maßgebliche Unterhaltsbetrag. Alles, was darüber hinaus erbracht wird, ist eine freiwillige Leistung.
Wie steht es um das Sorgerecht und den Kindesunterhalt beim Wechselmodell?
Betreuen Sie das Kind in zeitlicher und organisatorischer Hinsicht gleichermaßen, praktizieren Sie ein echtes Wechselmodell. Den allein betreuenden Elternteil gibt es dann nicht mehr. Ein echtes Wechselmodell führt aber nicht dazu, dass Elternteile von ihrer Barunterhaltspflicht befreit werden. Wäre dem so, müsste auch der andere Elternteil vom Barunterhalt befreit werden, obwohl durch Ihre abwechselnde Betreuung nur der Betreuungsbedarf des Kindes abgedeckt wäre. Beim echten Wechselmodell schulden deshalb beide Elternteile Barunterhalt. Dabei müssen Sie anteilig nach Ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen zum Kindesunterhalt beitragen.
Ein echtes Wechselmodell ist allerdings nur anzunehmen, wenn das Kind zeitlich und organisatorisch gleichwertig betreut wird. Daran fehlt es, wenn das Kind nur zu einem Drittel vom barunterhaltspflichtigen Elternteil (BGH, FamRZ 2006, 1015) oder wenn es regelmäßig an fünf von 14 Tagen sowie der Hälfte der Schulferien betreut wird (BGH, FamRZ 2007, 707). In beiden Fällen bleibt der barunterhaltspflichtige Elternteil verpflichtet, den vollen Kindesunterhalt als Barunterhalt zu zahlen. Ein Anspruch, dass der andere Elternteil das Wechselmodell akzeptiert, besteht aber nicht. Voraussetzung ist stets, dass Sie mit dem anderen Elternteil so kommunizieren und kooperieren können, dass Sie in der Lage sind, das Wechselmodell vernünftig und zum Wohl des Kindes zu praktizieren.
Wie steht es um den Kindesunterhalt, wenn kein Sorgerecht besteht?
Wurde dem betreuenden Elternteil entgegen dem ursprünglich bestehenden gemeinsamen Sorgerecht das alleinige Sorgerecht für Ihr gemeinsames Kind übertragen, bleibt der andere Elternteil trotzdem verpflichtet, in voller Höhe Kindesunterhalt zu zahlen. Allein die Tatsache, dass er kein Sorgerecht mehr innehat, rechtfertigt nicht, am Kindesunterhalt Abstriche zu machen. Das gemeinsame Kind bleibt trotzdem das Kind - auch wenn der nicht sorgeberechtigte Elternteil aus juristischer Sicht das Leben des Kindes nicht mehr beeinflussen kann.
Wie steht es um das Sorgerecht und den Unterhalt, wenn wir unverheiratet sind?
Unverheiratete Väter haben seit der Sorgerechtsreform von 2013 das Recht, gerichtlich prüfen zu lassen, ob ihnen das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. Voraussetzung dafür ist, dass die Mutter zustimmt oder die Übertragung dem Wohl des Kindes entspricht. Vätern muss danach der Zugang zu einer gerichtlichen Prüfung nach denselben Maßstäben offenstehen, wie den Eltern ehelicher Kinder im Fall einer Trennung (EuGHMR 2010, 103). Ungeachtet des Sorgerechts sind Sie auch als nichtehelicher Vater selbstverständlich verpflichtet, für das Kind Kindesunterhalt zu zahlen. Als rechtlicher Vater des Kindes gelten Sie aber erst dann, wenn sie die Vaterschaft anerkannt haben oder Ihre Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Ist dies der Fall, steht Ihnen ein angemessenes Umgangsrecht mit dem Kind zu.
Kann der Kindesunterhalt gekürzt werden, wenn der Umgang mit dem Kind hohe Kosten verursacht?
Wohnt das Kind weiter weg, muss der nicht betreuende Elternteil Kosten für den Besuch des Kindes alleine tragen. Es gibt keine Möglichkeit, den Kostenaufwand mit dem Kindesunterhalt zu verrechnen oder ihn dem anderen Elternteil in Rechnung zu stellen, mit der Begründung, der Elternteil habe mit dem Umzug in einen weiter entfernten Ort das Umgangsrecht beeinträchtigt (BGH, XII ZB 599/13). Auch kann der Betrag nicht als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden – dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Darf ich den Kindesunterhalt kürzen, wenn ich den Umgang mit dem Kind besonders intensiv wahrnehme?
Pflegt der zahlungspflichtige Elternteil mit seinem Kind einen gesteigerten Umgang, betreut das Kind übermäßig und gibt dadurch viel Geld aus, bleibt er trotzdem uneingeschränkt zur Zahlung des Kindesunterhalts verpflichtet (Kammergericht Berlin, 13 UF 164/15). Er hat auch nicht das Recht, seine Arbeitszeit zu reduzieren, nur um sich übermäßig um das Kind kümmern zu können. Wer die Arbeitszeit dennoch willkürlich reduziert, muss sich ein theoretisch erzielbares Einkommen fiktiv zurechnen lassen. Die Reduktion der Arbeitszeit würde nämlich zugleich das Gehalt und damit auch die finanzielle Leistungsfähigkeit sowie den Unterhaltsanspruch des Kindes verringern. Als Elternteil des Kindes besteht für ihn eine gesteigerte Erwerbspflicht (so OLG Bamberg, Beschluss v. 4.9.2019, 13 UF 77/19).
Wäre ein Verzicht des Sorgerechts mit einem Verzicht auf Kindesunterhalt zu vereinbaren?
Besteht das gemeinsame Sorgerecht, könnte der zahlungspflichtige Elternteil erklären, auf das Sorgerecht zu verzichten, wenn der andere Elternteil im Gegenzug auf den Kindesunterhalt für das Kind verzichtet. Eine solche Vereinbarung wäre jedoch rechtlich gegenstandslos. Nach § 1614 BGB kann nämlich niemand auf Unterhaltsansprüche für die Zukunft verzichten. Selbst wenn ein Ehepartner als Elternteil eine solche Verzichtserklärung abgeben würde, wäre diese rechtlich unverbindlich. Es bleibt bei der Pflicht zur Zahlung des Kindesunterhalts. Auf das Sorgerecht kann man allerdings verzichten.
Ist die Verpflichtung, Mehrbedarf oder Sonderbedarf zu zahlen, vom Sorgerecht abhängig?
Wer Kindesunterhalt zahlt, ist verpflichtet, aus begründetem Anlass über den bloßen Kindesunterhalt hinaus dem Kind auch Mehrbedarf oder Sonderbedarf zu zahlen. Muss das Kind beispielsweise im Kindergarten betreut werden, muss sich der zahlungspflichtige Elternteil an dem dadurch entstehenden Mehrbedarf beteiligen (BGH, VII ZR 65/07). Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Betreuung des Kindes allein dadurch notwendig wird, weil der andere Elternteil sich beruflich engagieren möchte (BGH, VII ZR 55/17). Die Verpflichtung besteht auch, wenn Sonderbedarf anfällt. Sonderbedarf wird durch einen Kostenaufwand begründet, der sich unvorhersehbar einstellt und die finanziellen Möglichkeiten des betreuenden Elternteils übersteigt (z.B. kieferorthopädische Behandlung).
Kann ich bei einem „Kuckuckskind“ den Kindesunterhalt verweigern?
Bis zur Scheidung oder bis zur erfolgreichen Anfechtung der Vaterschaft gilt der Ehemann als rechtlicher Vater des Kindes – auch wenn der biologische Vater ein anderer Mann ist. Sinnvollerweise steht dem rechtlichen Vater für ein solches „Kuckuckskind“ auch das Sorgerecht zu. Die Unterhaltspflicht endet erst, wenn gerichtlich festgestellt wird, dass es sich nicht um den leiblichen Vater handelt oder der leibliche Vater die Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter anerkannt hat.
Unterhalt bei „Kuckuckskind“
Auch, wenn der rechtliche Vater erfährt, dass das Kind ein „Kuckuckskind“ ist, hat die Ehepartnerin für den Zeitraum der Trennung Anspruch auf Trennungsunterhalt sowie nach der Scheidung Anspruch auf Ehegattenunterhalt. Allerdings kann der Vater mit guten Gründen darauf hinwirken, dass der Unterhalt herabgesetzt oder zeitlich begrenzt wird, wenn der Mutter ein „offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihr liegendes Fehlverhalten“ vorgeworfen werden kann (§ 1579 Nr. 7 BGB). Im Fall des OLG Hamm (8 UF 41/14) wurde der Wunsch der Frau nach einer höheren Unterhaltszahlung jedenfalls abgewiesen, da die Frau gegen die eheliche Solidarität verstoßen und ihrem Gatten über Jahre hinweg ein „Kuckuckskind“ untergeschoben habe.
Hat der rechtliche Vater keine Kenntnis, wer der leibliche Vater des Kindes ist, kann er die Unterhaltszahlung für das Kind zumindest solange verweigern, wie die Mutter sich weigert, den leiblichen Vater zu benennen. Nach einer Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz (7A 10300/18) hat eine Kindesmutter keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, solange sie das ihr Zumutbare unterlässt, um der Unterhaltsvorschussbehörde die Möglichkeit einzuräumen, den Kindesvater in Regress zu nehmen. Ein Recht, das der Unterhaltsvorschussbehörde zuerkannt wird, sollte auch dem rechtlichen Vater eines „Kuckuckskindes“ eingeräumt werden.